Vorhang auf für den Joker - JOKER
- Nikolas Friedrich
- 9. Okt. 2019
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 29. Juli 2023
Inhalt:
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) ist vom Leben gebeutelt. Mit seinem Job bei einer Clownsagentur kann er gerade so das heruntergekommene Apartment in Gotham City bezahlen, in dem er mit seiner Mutter haust. Eine rare Krankheit, die ihn in den unpassendsten Momenten in schrilles Lachen ausbrechen lässt, hält ihn zu seinen Mitmenschen auf Distanz. Die Zeiten sind schlecht, auf den Straßen regieren Unmut und Gewaltbereitschaft. Eine Reihe von Unglücksfällen, die über Arthur hereinbrechen, machen ihn unfreiwillig zur Galionsfigur einer politischen Bewegung gegen den kandidierende Bürgermeister Thomas Wayne (Brett Cullen). Aus dem Abgrund der vermodernden Unterschicht tritt er mehr und mehr in eine Sichtbarkeit. Der Joker macht seine ersten Schritte.
Kritik:
Von den filmübergreifenden Zwängen eines "shared cinematic universe" ist "Joker" freigemacht. Er darf unabhängig existieren, muss an keinen Vorgängerfilm anschließen und keiner Fortsetzung den Weg bereiten. Eine alte Version des Warner-Brothers-Studiologos beschwört zu Anfang ein klassisches Kino, das von seriellen Formaten etwaiger Konkurrenzunternehmen unlängst verabschiedet wurde. Todd Phillips aber möchte einen echten Film drehen. Im Zeitalter übereilig hochgezogener und noch eiliger wieder eingestampfter Franchise-Gerüste ist das wohltuend. In der Theorie zumindest. Denn das Bedürfnis, sich als ernstzunehmender Film verstanden zu wissen, wird "Joker" zum Verhängnis. Es überdeckt Nuancen, erdrückt Inhalt, dringt ihm auffällig aus jeder weiß übermalten Pore.

Anders als ihnen vorausgehende Filmemacher, möchten sich Regisseur Todd Phillips und Drehbuchautor Scott Silver in den Joker hineindenken. Ihn (be)greifen, erklären, eine für seine im selben Universum beheimateten Widersacher ganz gängige "origin story" erzählen. Wie wird man zu einer Person, die die Welt einfach nur brennen sehen möchte? In seinem Kultcomic "The Killing Joke" vermutete Alan Moore, dass „ein schlechter Tag" ausreiche, um eine Person in den Wahnsinn zu treiben. Der Joker in Christopher Nolans "The Dark Knight" dagegen verhöhnte seine Opfer, indem er ihnen widersprüchliche Geschichten über seine Vergangenheit auftischte. Ein gequältes Kind, ein verzweifelter Ehemann? Am Ende schnitt Batman ihm das Wort ab. Manche Dinge bleiben besser unausgesprochen.
Phillips und Silver denken ihren Joker zu einem Resultat sozialpolitischer Vernachlässigung um. Die erste Hälfte ihres Films ist beinahe ausschließlich der unaufhörlichen Malträtierung von Arthur Fleck gewidmet. Er wird ignoriert, ausgelacht, verprügelt, gefeuert und belogen. Schon in den ersten Minuten, wenn sich der Titel des Films über das Bild seines blutenden, zusammengeschlagenen Körpers legt, wird unmissverständlich klar: Hierbei handelt es sich um einen ernsten Film! Das lässt sich leicht mit Tiefgang verwechseln, ist aber eigentlich nur hohler Elendstourismus. Denn die Kritik an der „reichen Oberschicht“, die Arthurs Tour de Force und schlussendliche Transformation bedingen, formuliert der Film stets nur in Form vager Gesten.
Alles andere als vage gelingt dagegen das Psychogramm der Figur selbst. Die Idee, dass der Reiz des Jokers in seiner Rätselhaftigkeit liegt, scheint Phillips und Silver nicht gekommen zu sein. Die Prämisse ihres Films behauptet das Gegenteil. In Tagebüchern und Krankenakten sind die Gründe für Arthurs psychischen Zustand wortwörtlich ausbuchstabiert, in Großbuchstaben, schwarz auf weiß. Vor dem Abgrund der eigens gestellten Fragen fürchtet sich der Film, schreckt vor der Unerklärlichkeit des Wahnsinns zurück. Es bleibt nur die Flucht in plumpe Küchenpsychologie. Frei nach dem Motto: Diagnostizieren und entmystifizieren.
Es tut sich eine alles verschlingende Leere in "Joker" auf, da er seine Figur betreffend um keine Erklärung verlegen ist, sich gleichzeitig aber auch weigert, politisch konkret Stellung zu beziehen. "Joker" ist weder ein gewaltverherrlichender, die Gräueltaten seiner Figur unterstützender Film, noch entschuldigt er die gesellschaftspolitische Situation, die diese unfreiwillig in Auftrag gegeben haben. Soll heißen: Am Ende hat der Film nichts zu sagen. Er möchte – genau wie Arthur selbst, wenn er sich im Schlussakt der Welt offenbart - als apolitisch verstanden werden. Dass Silver und Phillips bis zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit ausgelassen haben, ihn als Opfer (und Ankläger) politischer Umstände zu zeichnen, ist plötzlich irrelevant.

Dass der Joker alles andere als eine apolitische Figur ist, hätte dem Film zu einer faszinierenden Widersprüchlichkeit verhelfen können. Die politische (Ent-)Haltung und das damit kollidierende Psychogramm der Figur als filmischer Ausdruck einer figurinternen Mentalität. Der Joker möchte die Welt in Flammen legen – aber warum? Der Film glaubt bis zum Schluss an (s)eine konkrete Antwort. Arthur darf (muss?) sie in Form eines zornig vorgetragenen Witzes sogar selbst ausformulieren. Diese faszinierende Widersprüchlichkeit ist vorhanden. Der Film versteht sie nur nicht. Das schmerzt, denn trotz alledem liegt ein zermürbender Reiz in "Joker". Wenn das Finale seinen Lauf nimmt, weiß er sogar richtiges Herzklopfen auszulösen.
Todd Phillips dirigiert kompetent und zunehmend selbstsicher durch den Film, läuft im Finale sogar kurz zu einer ungeahnten Hochform auf. Natürlich hat er sich viele schicke Bilder aus "Taxi Driver" und "The King of Comedy" abgeguckt. Die tragische Ironie beider Filme, vielleicht ihre entscheidende Stärke, fehlt aber. Für Humor ist "Joker" sich zu wichtig. Phillips' überdeutliche, dem Publikum nie wirklich Vertrauen schenkende Regie überlagert beinahe den großartigen Joaquin Phoenix. Der wirft sich mit einer beeindruckenden, wenngleich vom Film etwas zu stolz ausgestellten Körperlichkeit in die Rolle. Bis zum Schluss scheint er gegen die Oberflächlichkeit anzukämpfen, die das Drehbuch ihm diktiert. Joker ruht auf seinen knochigen Schultern.
Fazit:
Der Hang zur wichtigtuerischen Pose und ausgestellten Tiefsinnigkeit liegt über jedem von Lawrence Shers verregneten Großstadtbildern, dringt aus jeder Note von Hildur Guðnadóttirs bräsiger Streichermusik. "Joker" ist so vernarrt in den eigenen Ernst, so überzeugt von der eigenen Bedeutsamkeit, dass er beinahe zur Selbstparodie wird. Euphorische Publikumsreaktionen und die Verleihung des Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig legen nahe, dass man das brillant finden sollte. Ist es aber nicht. Am Ende ist "Joker" nur voller uninteressanter Widersprüche und Enthaltungen. Es ist ein leerer, nichtssagender Film - und damit womöglich seiner Figur angemessen. Trivia & Fun-Facts: - Laut Joaquin Phoenix war der schwierigste Part das perfekte lachen des Jokers hinzubekommen
- Joaquin Phoenix war mit dem verstorbenen Heath Ledger sehr gut befreundet, der für seine Darstellung als Joker in "The Dark Knight" einen Oscar gewann
- Das Make-up vom Joker ähnelt dem von John Wayne Gacy, der als Pogo der Clown oft Kinder unterhielt. Er war ein Serienmörder aus den USA, der für die Vergewaltigung und Ermordung von 33 Jungen und jungen Männern in den Jahren 1972 bis 1978 verurteilt wurde
- Joaquin Phoenix verlor viel Gewicht für seine Rolle als Joker
- Der erste Kinofilm von DC Comics, der seit "Watchmen: Die Wächter" (2009) in den USA mit "R" bewertet wurde

Bilder und Trailer: © Warner Bros. Entertainment Inc.




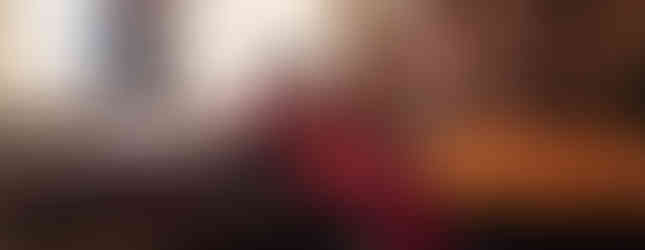







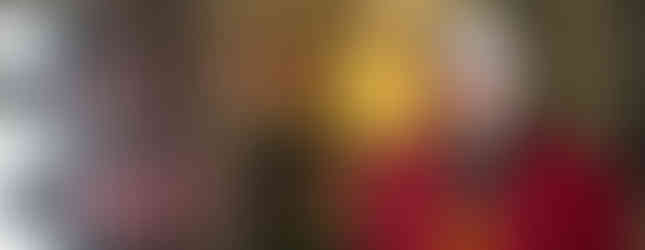









Comentarios